Vorbilder auf dem Weg...
Einleitende Hinweise:
- Ich gebe in diesem Bereich keine vollständige Darstellung (Biographie) über Jesus Christus, sondern stelle einzelne Eigenschaften von Jesus dar, wo er für uns ein Vorbild darstellt in seiner Hingabe, Dienst usw.
- Es sind Eigenschaften, wo uns Jesus Christus «Impulse auf unserem Weg» geben kann.
Seine Hingabe für uns Menschen:
Eine Textpassage, Philipper 2,7-8 gibt uns auf eindrückliche Weise wieder, wie Jesus Christus bereit war, sich für uns Menschen «hinzugeben».
7 «Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden,
8 erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz.»
Sich entäussern, wie die Elberfelder Übersetzung formuliert meint, dass er sich «entleerte, entblösste, sich beraubte…». Diese etwas spezielle Formulierung will betonen, dass er bereit war, sich auf die Welt senden zu lassen und an dem «Gott-Gleich-Sein» nicht festhielt.
Er nahm «Sklavengestalt» an, was heisst, dass er freiwillig bereit wurde wie ein Knecht/Sklave zu dienen. Das Nomen δοῦλος= doulos meint ein Sklave, der in einem Dauerverhältnis zu einem anderen steht und dessen Wille gänzlich im Willen des anderen verschwindet (Mt 8,9; 20,27; 24,45f u.ö.).

Ja, das ist ja die gewaltige Botschaft des NT, dass Christus Mensch wurde, obschon er jederzeit auch Gott war und blieb. Aber so konnte er als «Gott» für uns sterben, an unserer Stelle – Stellvertretung nennt die Bibel dies.
Weil Jesus Christus Mensch wurde, konnte und kann er uns in unserem Mensch-Sein verstehen (Hebr 2,14-18).
Hier könnten wir nun eintauchen in das gewaltige Thema der Reformation, Rechtfertigung aus Glauben (vgl. dazu die Schriftstelle Röm 3,23ff).
Jesus Christus ist uns also ein Vorbild in der Hingabe für andere, für dich und mich. Jesus wurde ein δοῦλος und in Joh 4,19 sagte Jesus auch, «dass er nur das tut, was er den Vater tun sieht».
Er geht voran und «weidet» (Guter Hirte):
Hier könnten wir endlos Schriftstellen anführen, wie Jesus Christus leitete, führte und voranging. Immer, und dies will ich hier betonen, ging es Jesus um Menschen. Sein Anliegen war und ist es noch heute, sich um sie kümmern.
Jesus nahm das Bild des Hirten auf, als er die Fürsorge und das «Sich kümmern» um Menschen darstellte. Joseph Ratzinger (S. 317), also Benedikt der XVI. schreibt hierzu folgendes:

«Das Bild des Hirten, unter dem Jesus sowohl bei den Synoptikern wie im Johannes-Evangelium seine Sendung darstellt, trägt eine lange Geschichte in sich. Im alten Orient, sowohl in den sumerischen Königsschriften wie im babylonischen und assyrischen Raum, bezeichnet sich der König als der von Gott eingesetzte Hirte, «weiden» ist ein Bild für seine Aufgabe des Regierens.
Die Sorge um die Schwachen gehört von diesem Bild her zu den Aufgaben des gerechten Herrschers.
So könnte man sagen, dass von seinen Ursprüngen her das Bild von Christus dem guten Hirten ein Evangelium von Christus dem König ist, dass es das Königtum Christi aufleuchten lässt.»
- «Weiden», das stellt dar, dass es Christus nicht um sich selber und den Profit geht, sondern um Menschen, um die er sich sorgt/kümmert.
- Wie so ganz anders sehen wir dies bei Wirtschaftsführern oder Staatspräsidenten, denen es oft mehr um den Ausbau ihrer Macht, statt um das Volk geht.
- Wohl am schönsten, so Joseph Ratzinger weiter (S. 318) finden wir dies bei Jesus Christus:
«Wohl am schönsten zusammengefasst ist diese Frömmigkeit des Vertrauens in Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte - ´Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil. Denn du bist bei mir…».
Jesus als Vorbild kümmert, sorgt sich um mich, dich. Er gibt nicht nur Befehle oder gibt die Richtung an, in die ich gehen soll, sondern er geht voran (Johannes 10,4):
Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen.
Er ist da. Er sorgt sich um mich. Er geht nicht weg, wenn Gefahren drohen, sondern er bleibt da, er «weidet».
Seine Demut im Dienen:
Jesus ist auch ein Vorbild im Dienen. Vermutlich die idealste Schriftstelle, jedenfalls wenn es um den krassen Vergleich zu den übrigen Anwesenden geht, ist wohl der Bericht der Fusswaschung von Jesus in seinem Jüngerkreis (Joh 13, 1-20).
- Zu jener Zeit wanderte Jesus und seine Jünger auf staubigen Strassen und in Sandalen.
- Als nun Jesus sich mit seinen Jüngern zum Passah-Mahl traf (Joh 13,3ff) war offensichtlich kein Diener da und keiner der Jünger bereit, diesen «niedrigen» Dienst der Fusswaschung zu übernehmen. Einer tat es dann – Jesus.
- Nachdem Jesus diesen niedrigen Dienst vollendet hatte, lesen wir in Joh 13,13-17 seine Anwendung:

13 »Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es.
14 Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen.
15 Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.
16 Denkt daran: Ein Diener ist nicht größer als sein Herr, und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet.
17 Ihr wisst das jetzt alles; glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt.
- Dienen, sich nicht bedienen lassen oder zusehen, wie andere dienen – das entspricht der Gesinnung und dem Vorbild von Jesus Christus.
- Den ersten Schritt tun und so ein Vorbild geben im Dienen. Zusammengefasst ist die Bereitschaft von Jesus, anderen zu dienen, wohl am Besten in Mk 10,45:
Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben.
Seine Bereitschaft für Beziehungen zu Menschen aus verschieden sozialen Schichten:
Besonders Lukas, der Verfasser von dem Lukas-Evangelium will uns zeigen, dass in Jesus Christus Gottes Liebe zu allen Menschen gekommen ist. Besonders die Abschnitte des «Sonderguts» machen immer neu deutlich: Jesus ist gekommen, um das Verlorene zu suchen, er wendet sich auch Aussenseitern zu – Kranke, Aussätzige, Arme, Zöllnern, Frauen, Kinder und Sünder.
Auch die Frauen spielen bei Lukas eine grössere Rolle als in den anderen Evangelien. Gottes Erbarmen ist in Jesus zu allen Menschen gekommen – mit dem Ziel, dass der Sünder umkehre. Beachte zu den Beziehungen von Jesus zu unterschiedlichen Personen besonders Lk Kp 5,27ff; 7,40; 8,2f.; 8,30; 10,38ff.; 13,11-13; 17,11ff.; 18,15-17; 18;38-43; 19,5-10.
Judah Smith schreibt in «Jesus ist», S. 48:
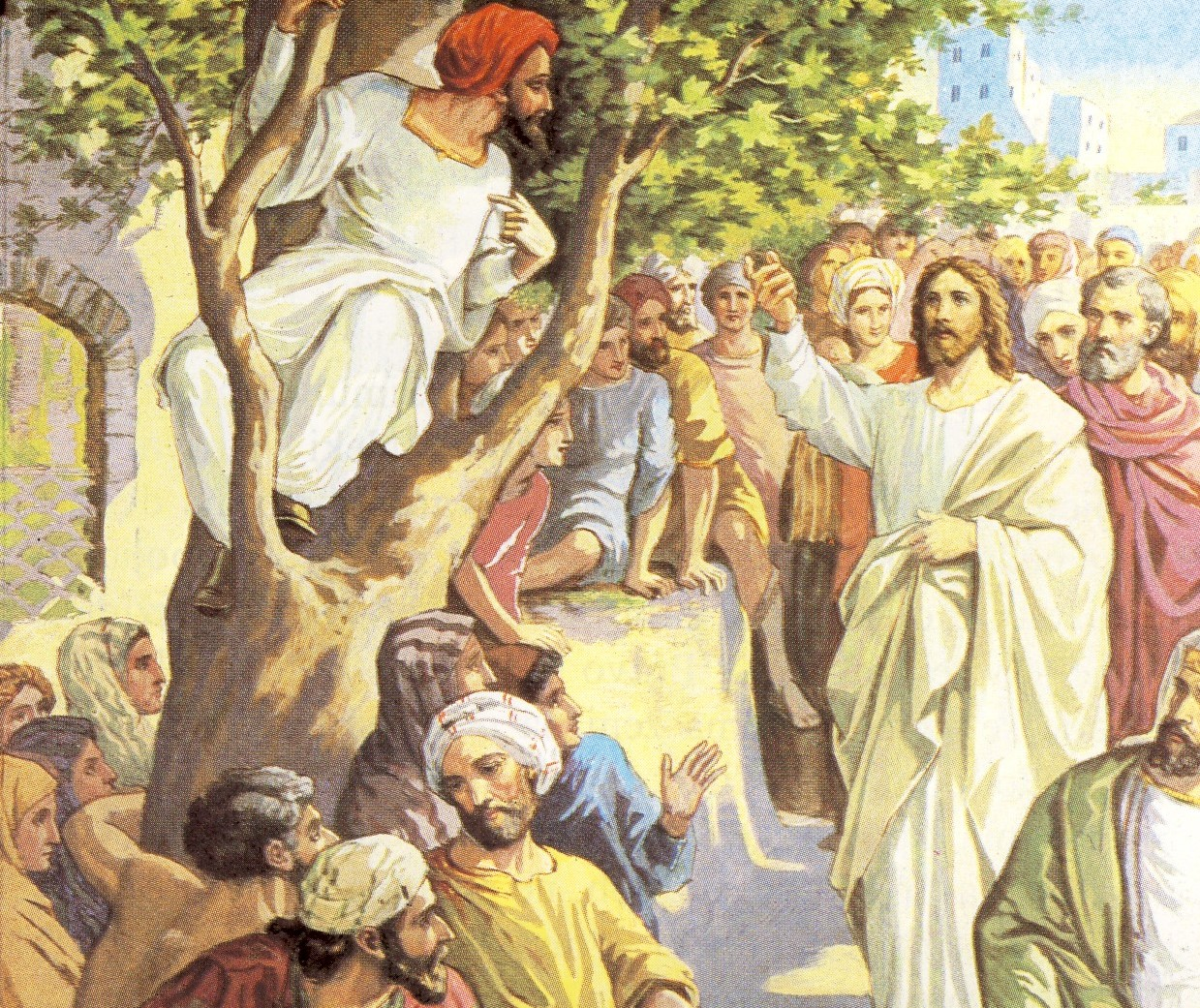
«Er redete mit ihnen, ass mit ihnen, weinte mit ihnen und diente ihnen. Die Menschen waren für nicht nur ein soziales Projekt. Er hatte sie gern und hörte ihnen zu. Er bot Hoffnung und Erbarmen an. Ohne Bedingungen…
Er begab sich auf ihre Ebene hinab, weil sie es nie geschafft hätten, auf seine zu kommen. Sein Ziel war nicht zu beweisen, wie gut er war oder wie schlecht sie waren. Er wollte ihnen einfach nur Hoffnung anbieten.
Jesus ist ein Freund von Sündern. Jesus ist der Freund der Menschen, die zugeben, dass sie Probleme haben. Wenn wir verstehen, dass wir Schwierigkeiten haben, wenn wir erkennen, dass es da Dinge gibt, die wir einfach nicht hinkriegen, dann ist Jesus uns nach. Du musst nicht gut sein, um Jesus zum Freund zu haben. Du musst nur ehrlich sein.»
Grundsätzlich legt Jesus den Schwerpunkt auf Beziehung und nicht auf Wissen oder Intellekt:
Günter Krallmann schreibt in «Leidenschaftliche Leiterschaft», S. 72:

«Jesus betrachtete den Prozess der Jüngerschaftsschulung als einen dynamischen Vorgang, in dem das Denken und die Lebensweise seiner Schüler Stück für Stück ihm gleichgestaltet werden sollten…
Jesus betrachtete die Formung zu Jüngern als eine Übertragung seines Lebens auf dem Weg der Beziehung und nicht nur als eine rein intellektuelle Akzeptanz bestimmter theoretischer Grundsätze.»
- Der allgemeine Begriff der Jüngerschaft war keineswegs neu, als Jesus Männer und Frauen dazu rief, ihm nachzufolgen. Es überraschte deshalb nicht, dass, obwohl das Verb „zu einem Jünger machen“ (manthano) im neuen Testament nur 25 mal vorkommt (sechsmal in den Evangelien), das Substantiv „Jünger“ (mathetes) nicht weniger als 264 mal auftritt, und zwar exklusiv in den Evangelien und der Apostelgeschichte.
- Mark Batterson, in «Zurück zum wichtigsten Gebot», S. 130 schreibt: «Das neutestamentliche griechische Wort, das mit ´Jünger´ übersetzt wird, hat eine Wurzel, die Lernender bedeutet. Per Definition ist ein Jünger somit jemand, der niemals aufhört, zu lernen. Ein wahrer Jünger nutzt die hundert Milliraden Gehirnzellen, die Gott leihweise in ihn eingepflanzt hat, so gut wie möglich. Ein wahrer Jünger liebt mehr, weil er mehr weiss. Ein wahrer Jünger ist voll heiliger Neugier und akzeptiert kein Ja als Antwort. Der Jünger bittet und sucht und klopft beständig (Matthäus 7,7-8). Und diese Reise ist niemals zu Ende, weil die Fragen nie ausgehen.»
- Jesus sprach nie abstrakt von einem Konzept der Jüngerschaft, sondern war konkret. Nach Mk 3, 13-14 lernen wir einen weiteren Aspekt von Jesus in seinen Beziehungen, was er unter einem «effektiven Lernumfeld» verstand. Er hat die Jünger zu sich eingeladen, dass sie mit ihm unterwegs sind und der sie dann aussendete. Zudem wählte er für «Das Lernen und Prägen» den äusseren Rahmen von einem Team. Ein Team weckt ein Gefühl der Zugehörigkeit und Sicherheit, fördert gegenseitige Ermutigung, regt an und fordert heraus.
Die Ausbildung von Jüngern bei Jesus war einfach. Hier den Beleg dafür:
- Phase 1: Kommt und seht (Joh 1,39-4,46)
- Phase 2: Kommt und folgt mir nach (Mt 4,18-22; Mk 1,16-20)
- Phase 3: Kommt und seid bei mir (Mk 3,13-14; Lk 6,13)
-
Phase 4: Bleibt in mir und macht zu Jüngern (Joh 15,7-8; Mt 28,18-20; Joh 16,7-8; Apg 1,8).
Weiter können wir von Jesus auch erkennen, dass er in der Schulung seiner Jünger nach gewissen Grundsätzen/Prinzipien gehandelt hat. Hier den Beleg dafür:
- Prinzip 1: Ihnen sagen, warum (Lk 19,10; Mk 10,45)
- Prinzip 2: Ihnen zeigen, was (Joh 1,35-46; Mk 1,16-17; Mt 9,36-38; Mt 28,19-20)
- Prinzip 3: Ihnen zeigen, wie (Mk 10,13.16)
- Prinzip 4: Es mit ihnen machen (Mt 14,13-21)
- Prinzip 5: Es sie machen lassen (Mt 10,1.5-42; Lk 10,17-20)
- Prinzip 6: Sie loslassen (Joh 16,7; Apg 1,8).
Seine Priorität für und im Gebet:
Hier könnten wir eine sehr ausführliche Betrachtung machen. Ich will aber hier lediglich auf drei Situationen während seinem Dienst aufmerksam machen, um darzulegen, dass Jesus sich immer wieder Zeit für das Gebet und somit das Gespräch mit seinem Vater nahm.
Gebet, um Klarheit über die Priorität zu bekommen:
Die Wirksamkeit von Jesus in Kapernaum (Mk 1,21ff) und die Begeisterung unter dem Volk war beeindruckend. Er lehrte mit Vollmacht, befreite Menschen von unguten Bindungen (Dämonen), heilte die Schwiegermutter von Petrus wirkte bis in die späten Abendstunden. «Die ganze Stadt versammelte sich vor der Tür», lesen wir in Mk 1,33.
Am nächsten Tag, so lesen wir in Mk 1,35 zog sich Jesus zurück, um zu beten:
Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten.
Die Jünger suchten Jesus, weil das Volk Jesus aufsuchte. Vermutlich, damit er den Heilungsdienst fortsetzte. Aber Jesus hatte offensichtlich im Gebet mit dem Vater Klarheit bekommen, dass seine Priorität woanders ist und der Focus besonders auf der Verkündigung des Reiches Gottes ist (1,38).
Gebet, während der ersten Zeit seines Heilungsdienstes (Lk 5,12ff.):
Im Lukasevangelium, Kp 5 ab Vers 12 berichtet Lukas über die Heilungstätigkeit von Jesus. Und dann berichtet Lukas in Vers 16 folgendes:
Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete.
Curtis C. Mitchell schreibt in Jesus als Beter, S. 14 folgendes zu dieser Situation:
«Der Ausdruck ´zog sich zurück´ beschreibt eher eine gewohnheitsmässige Handlung als eine einmalige Tat. Was hier vor sich geht, wird uns sehr lebendig dargestellt. Die Massen, ganz wild vor Begeisterung über die Heilungskraft Jesu, umgaben ihn ständig, Tag für Tag (V.15), während er jede Gelegenheit wahrnahm, dem Gedränge heimlich zu entfliehen.
Immer wieder ging Jesus von den Menschenmengen fort, um im Gebet die Leitung des Vaters zu suchen. Er mag ungefähr so gebetet haben: ´Vater, mein menschliches Ich ist ja ganz angetan von all dem Ruhm, den ich hier ernte, aber ich bin doch nicht auf dieser Erde, um mir selbst einen grossen Namen zu machen. Ich bin hier, um deinen Willen zu tun. Vater, was soll ich tun? Soll ich hierbleiben und mich in diesem Ruhm sonnen? Oder soll ich weitergehen, um Israel deine Botschaft zu verkündigen?´»
Gebet vor oder für die Auswahl seiner Jünger (Apostel); Lk 6,13-16:
Über den Zeitpunkt dieser Begebenheit kann man nichts genaues sagen. Die meisten Gelehrten nehmen an, dieses Ereignis habe kurz vor der Bergpredigt stattgefunden.
Jesus bewegte offensichtlich die Frage, welche von seinen Jüngern er für wichtige Führungspositionen (Apostel) wählen soll.
In diesem Text (und Situation) wird von Lukas berichtet, dass Jesus die mühsame Bergtour ausschliesslich unternahm, um zu beten.
- Es war ja nicht so, dass er wegging, um ein bisschen Körperbewegung zum haben und dann, nachdem er ein Weilchen gewandert war, zum Schluss kam, es wäre ganz nett, nun noch zu beten.
- Nein, seine Gebetszeit dauerte die ganze Nacht hindurch. Das Wort, das hier mit «die ganze Nacht» wiedergegeben wird, ist ein Ausdruck, der in der Medizin gebraucht wurde. In der griechischen Literatur verwendete man dieses Wort, um die Nachtwache eines Arztes zu beschreiben, der die ganze Nacht am Bett seines Patienten zubringt und sich aufopfernd um ihn müht. Dieser Ausdruck beinhaltet den Gedanken von Dringlichkeit, Ernsthaftigkeit und Intensität.
Jesus suchte hier – und auch an anderen Stellen, wo er sich für das Gebet und Reden mit dem Vater zurückzieht – das Gespräch und Hilfe bei dem Vater. Welche Entscheidung soll er treffen. Welchen Personen soll er Verantwortung übertragen und Zeit in sie investieren.
Ein «Mustergebet» für seine Jünger & Nachfolger, um darzulegen und dann im Vollzug des Betens uns in Erinnerung zu rufen, was wir in unserem Leben die Prioritäten legen sollen:
Ein einziges Mal hat Jesus über das Gebet eine ausführliche Belehrung gegeben, und zwar, als er das sogenannte «Gebet des Herrn» lehrte. In Wirklichkeit hat Jesus es aber selbst gar nicht gebetet. Er hatte es zum Beispiel nicht nötig zu sagen: «Vergib uns unsere Sünden», weil er der Eine, der absolut Sündlose war.
Genausgenommen handelt es sich hier also um ein «Lehrgebet». Weil es aber ein Lehrgebet ist, zeigt es uns die vollkommenste Art zu beten.
Hier nun das Gebet, wie uns dies Matthäus in Kp 6,9-13 mitteilt:
Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. [Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.]
Erklärung zum Abschluss in Klammern […]. Dieser Abschluss ist in den ältesten Handschriften nicht enthalten.
Hilfreiche Literatur für weitere Vertiefung in das Thema:
- Bill Hybels; Hinabsteigen zur Grösse
- Curtis C. Mitchell; Jesus als Beter
- Erwin W. Lutzer; Seine schwerste Stunde
- Joseph Ratzinger (Benedikt XVI); Jesus von Nazareth – Erster Teil von der Taufe im Jordan bis zur Verklärung
- John Ortberg; Weltbeweger – Jesus, wer ist dieser Mensch?
- Judah Smith; Jesus ist - .
- Michael Herwig; Komm zum Kreuz
- Timothy Keller; Jesus – Seine Geschichte, unsere Geschichte
Einleitende Hinweise:
- Etwas 2/3 aller Leiter oder bekannten Personen der Bibel hatten ein schlechtes Ende.
- Dr. Bobby Clinton, ehemaliger Professor für Leiterschaft am Fuller Seminary in Kalifornien, hat die Frage untersucht, wie viele der in der Bibel erwähnten Personen wirklich «DranbleiberInnen» waren. Dabei nahm Clinton vor allem die biblischen Führungspersönlichkeiten unter die Lupe.
- Knapp 1000 Führungspersönlichkeiten werden im Alten und Neune Testament namentlich erwähnt. Von diesen 1000 werden circa 100 etwas näher vorgestellt. 49. Personenbeschreibungen liefern ausreichend Informationen, um Rückschlüsse darüber zu ziehen, ob diese Persönlichkeiten wirkliche DranbleiberInnen waren oder nicht.
Ich konzentriere mich bei diesem Bereich «Personen der Bibel als Vorbilder» auf die Kategorie der DranbleiberInnen. Denn, voller Begeisterung auftauchen und etwas Neues wie aus dem Boden entstehen lassen, das können Viele Menschen. Da gab es auch einige Personen in der Bibel, die in diese Kategorie eingereiht werden könnten. Aber ich will mich nicht auf sie konzentrieren, denn als Vorbilder will ich jene Personen der Bibel kurz vorstellen, die wirklich drangeblieben sind.
Bei den Personen, die ich vorstelle und wirklich Vorbilder waren handelt es nicht um Personen, die alles richtig gemacht haben, sondern die auch bereit waren, Fehler einzugestehen, umzukehren – konkret: «Die lernfähig waren». Clinton Beschreibt fünf Merkmale von Menschen, die in ihrer geistlichen Entwicklung ein gutes Ende genommen haben, sogenannte «Dranbleiber/Dranbleiberinnen»:
- Erstens: DranbleiberInnen haben einen Weitblick, der es ihnen möglich macht, sich auf das Ziel zu konzentrieren.
- Zweitens: DranbleiberInnen geniessen den vertraulichen Umgang mit Christus und erleben immer wieder Zeiten der persönlichen Erneuerung.
- Drittens: DranbleiberInnen leben in den wichtigsten Bereichen des Lebens diszipliniert und Praktizieren geistliche Übungen.
- Viertens: DranbleiberInnen sind das ganze Leben lang bereit zu lernen.
- Fünftens: DranbleiberInnen haben ein Netzwerk bedeutungsvoller Beziehungen und verschiedene wichtige Mentoren in ihrem Leben.
In den folgenden Betrachtungen über die Personen, welche ich als Vorbilder darstellen will, geht es darum, dass diese sich von der Menge abheben. Ihr Verhalten ist vorbildlich und bemerkenswert und kann uns motivieren, Schritte des Vertrauens und Glaubens zu gehen – sogenannte «Nachahmer» dieser Vorbilder zu werden.
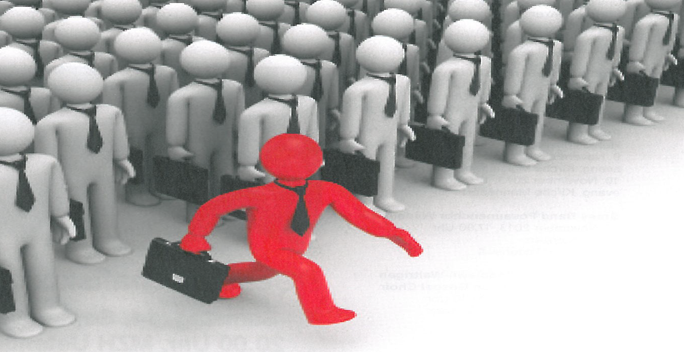
Abraham: Der, mit dem Gott einen neuen Anfang machte:
Die Geschichte Abrahams beginnt nicht damit, dass er Gott suchte, sondern dass Gott ihn suchte – so zitiert nach Roland Hardmeier, Der Triumph des Königs, S. 77.
Abraham kannte den Gott der Bibel nicht. Mann nennt Abraham, dessen Name ja zuerst «Abram» war, auch den Vater des Glaubens. Die Geschichte Gottes mit Abraham ist geprägt von Vertrauen und einer einzigartigen Beziehung, mit Bundesschlüssen, Gottes Verheissungen und Gottes Führung.
Mit Genesis 1, 1-4 beginnt die Geschichte Abrahams:
1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde!
2 Und ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein!
3 Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde!
4 Und Abram ging hin, wie der HERR zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog.
- Jahwe sprach zu Abraham und er hörte auf seine Stimme;
- Abraham bekam die Zusage von Jahwe, dass er ihn segnen wird und seinen Namen gross machen will;
- Abraham war bereit zu gehen, auf das Reden von Jahwe zu hören und das gewohnte Umfeld zu verlassen.
Diese Aspekte haben Wesentlich mit Glauben und Beziehung mit Gott zu tun. Immer wieder wiederholt sich dies in der Bibel und wenn Menschen auf dieses Angebot Gottes, seinen Ruf hörte, kam Segen in ihr Leben.
Miroslav Volf bezeichnet das Verlassen von seinem Umfeld als abrahamitische Revolution (S. 42):
«Abraham entschloss sich zu gehen. Der Mut, kulturelle und familiäre Banden zu durchbrechen und die Götter der Vorfahren zu verlassen (Josua 24,2) aus Loyalität zu einem Gott aller Familien und aller Kulturen war die eigentliche abrahamitische Revolution.
Das Verlassen des heimatlichen Bodens machte Abraham nicht weniger als sein Vertrauen, dass Gott ihm einen Erben geben würde, zu unsere alle Stammvater (vgl. Hebräer 11,8). «
Abraham geht – er verlässt sein Umfeld und zieht los, obschon er Jahwe gar nicht kannte. Glaube, das erkennen wir an diesem Aspekt deutlich hat somit Wesentlich zu tun mit Gehen, Vertrauen, Aufbrechen.
Miroslav Volf schreibt dazu (S.45): «Aufbrüche ohne jede Vorstellung von Ursprung und Ziel sind keine Aufbrüche; sie sind nur unablässiges Umhergehen, so wie Bäche, die in jede Richtung zugleich fliessen, keine Bäche, sondern am Ende ein Sumpf, in dem jede Beweg zur tödlichen Ruhe gekommen ist.»

Es lohnt sich, die Geschichte von Abraham in der Bibel weiter zu lesen. Abraham war unterwegs -unterwegs in das Land, das Gott ihm zeigen wird. Hier ist auch eine Parallele zu uns, zu dir, wenn du dich Christ nennst. Wenn Gott ruft, in seine Nachfolge ruft, dann beginnt für uns ein «Exodus». Dies muss nicht beinhalten, dass wir den Wohnort verlassen, sondern dass wir uns innerlich von dem Umfeld und Abhängigkeiten unserer bisherigen «Götter/Einflüssen/Prägungen», loslösen sollen und unser Leben nach dem Gott der Bibel gestalten und prägen lassen sollen. Hilfreiche Wegleitung dazu findest du in dem Buch Christen sind Fremdbürger von Stanley Hauerwas & Willim H. Willimon.
Kaleb: Der, der einfach anders war:
Die Geschichte von Kaleb begeistert mich immer wieder. Vor einigen Jahren startete ich in der Kirche ein «Kaleb-Treffen». Kaleb stand (und steht für mich weiterhin) für einen Menschen, einen Mann, der einfach anders war. An Kalebs Mut und Geist kann ich mir eine grosse Scheibe abschneiden.
Hintergrund zur Person und dem Mut von Kaleb:
Wir kennen die Geschichte des Volkes Gottes, welches aus Ägypten, aus der Gefangenschaft zog und unterwegs in das von Gott verheissene Land war.
Wir kennen auch die Geschichte, wo Gott Mose den Auftrag gab, „Kundschafter“ in das von Gott verheissene Land auszusenden (4. Mose 13, 1ff). Und dann gingen sie in dieses Land und erkundeten es. Alle zwölf Kundschafter waren an denselben Orten, alle bekamen den gleichen Einblick in das Land - und doch war ihr Bericht (Analyse) dann so verschieden (4. Mose 13, 27-33). Wir sehen, erkennen:
- Das Denken der zehn anderen Kundschafter: „Food ist gut, aber uns fehlt der Mut“. So konkret formulierten sie es nicht, das mit dem fehlenden Mut meine ich. Aber sie hatten Angst. Sie sahen zwar, dass das Land gut war, dass „Milch und Honig fliesst“ (4. Mose 13,27), und dann kommt das „ABER“: Bewohner zu stark; Bewohner führen ständig verlustreiche Kriege; und da sind „Riesen“ – wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen (4. Mose 13, 31-33).
- In Kaleb war ein anderer Geist (4. Mose 14, 24): „Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen…“, so war der ganz andere Standpunk von Josua und Kaleb (4. Mose 14, 6-9) – das war das Motto von Josua und Kaleb.
Wir wissen von dem biblischen Bericht, dass nur Kaleb und Josua in das verheissene Land kamen. Alle anderen drehten „Zusatzrunden“, als Lektion der falschen Analyse, der Auflehnung in der Wüste. Für jeden Tag der falschen „Sichtweise“ und Berichterstattung ein Jahr – 40 Jahre in der Wüste (4. Mose 14, 34). Sie versuchten zwar aus „eigener Kraft» in das Land zu kommen, aber sie wurden zurückgeschlagen (4. Mose 14, 40 – 45).
Was lerne ich, wir von Kaleb?
Er blieb dran, dieser Kaleb, der einfach anders war. 45 Jahre (vgl. Josua 14.7.10) nach diesen Ereignissen in der Wüste, bei der „Landverteilung“ im verheissenen Land begegnet uns Kaleb wieder. Im Alter von 85 Jahren steht er Josua gegenüber und will seinen Erbteil entgegennehmen (lese dazu Josua 14, 6-15).
Drei Aspekte, die ich von dem Vorbild Kaleb für mich mitnehmen will:
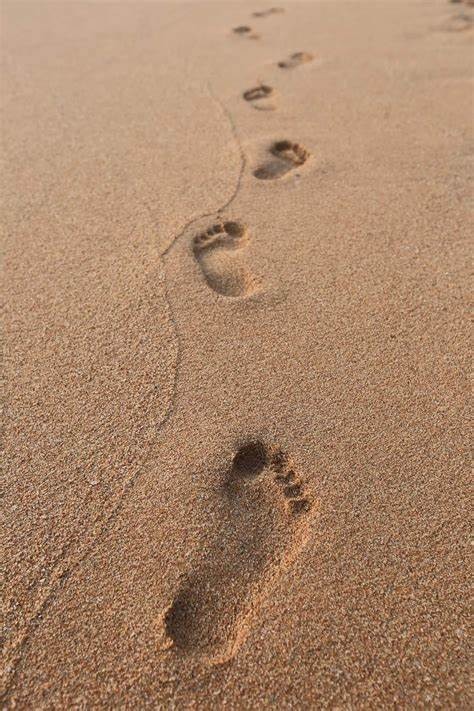
Erstens: Kaleb ist auch im Alter von 85 Jahren Optimist geblieben: Er wollte das Land mit Gottes Hilfe einnehmen, damit es seine Nachkommen empfangen, wie Mose es ihm versprochen hatte (4. Mose 14, 24; Jos. 14,12). Dort im Gebirge wohnten die «Enakiter», also die Riesen. Mögliche Frage: Wo liegt das Geheimnis von diesem gewaltigen Optimismus des Kaleb begründet?
Zweitens: Kaleb erlebte Gottes Kraft – er sagte, dass er noch so fit sei wie vor 45 Jahren: Mögliche Frage: Ist das überhaupt möglich oder ist das bloss „bildhafte Sprache“? Was meinst du?
Drittens: Kaleb empfing Segen (offensichtlich dadurch, dass Gott ihm Kraft und Ausdauer gab – aber auch ein Segensgebet durch Josua, weil Kaleb dem HERRN treu nachgefolgt war (Josua 14, 14). Mögliche Frage: Was lernst du über die Treue in der Nachfolge mit Gott, verdeutlicht an dem Beispiel von Kaleb?
Hanna: Die, die ihre ganze Not zu Gott brachte:
Hintergrund zur Person und der Situation von Hanna:
- 1. Sam 1, 1-5: Elkanas Entscheidung, sich zwei Frauen zu nehmen, führte zu Spannungsfeldern im familiären/gesellschaftlichen Umfeld. Hanna hatte keine Kinder, weil der HERR den Mutterleib von ihr verschlossen hatte (1.Sam 1,5).
- 1. Sam 1, 6-8: Kränkungen, Benachteiligung usw. können uns manchmal so stark verletzen, dass die „menschliche Liebe“ (V. 5) und auch die „Warum-Fragen“ (V. 8) den Schmerz nicht stillen und zu keiner befriedigenden Antwort führen.
- 1. Sam 1, 9-11: Manchmal gilt es Spannungen/unvollkommene Situationen auszuhalten (V. 9, denn Hanna zog sich bei dem gemeinsamen Essen nicht zurück…), aber es ist gerade in solchen Situationen dann wichtig, nicht im Mitleid zu versinken, sondern aufzustehen (V. 9) und Hilfe bei Gott zu suchen (V. 10ff).
- 1. Sam 1, 12-16: Ungewöhnliche Situationen können uns „mutig“ machen, Wege zu gehen und Hilfe zu suchen, sie wir sonst nicht erleben. Die ganze Haltung und Ernsthaftigkeit des Gebetes von Hanna muss Eli aufgefallen sein, so dass er dachte, Hanna wäre betrunken (V. 14).
Was lerne ich, wir von Hanna?

Erstens: Es war Gott, der Hanna diese Situation zumutete und also damit auch ein Ziel hatte für ihr Leben, ihre Beziehung zu Gott.
Zweitens: Zuwendung und Liebe von Menschen vermögen manchmal den innersten Schmerz in unserem Herzen nicht zu stillen.
Drittens: Wir sind noch nicht im Himmel und solange das so ist, wird es Benachteiligungen, Kränkungen und schwierige Situationen in unserem Leben geben.
Viertens: Die entscheidende Frage ist, was wir mit unserer Not machen – „verbittert“ werden, oder Hilfe und Trost bei Gott suchen.
Fünftens: Nicht im „Klage-Tal“ zu bleiben, sondern „aufzustehen“ und Zuflucht bei Gott zu suchen und mit dem „Frieden Gottes“ im Herzen weiter zu gehen (V. 17-18) ist die Lösung.
David: Der Mann nach dem Herzen Gottes:
Der erste König im alten Israel, Saul, war nicht lange im Amt. Er scheiterte, weil er Gott in einer Situation (1. Samuel 13) nicht vertraute und die Situation selber in die Hand nahm.
Der Prophet Samuel sprach dann zu ihm, 1. Samuel 13,14:
Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der HERR hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der HERR hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk; denn du hast das Gebot des HERRN nicht gehalten.
Nun, wenn du die Geschichte von König David etwas kennst, dann kennst du nicht nur seine grossen Siege, sondern auch seine Niederlagen. Eine Niederlage von David war, dass er das «Gebot des HERRN», die Ehe nicht zu brechen, nicht befolgte.
- In 1. Samuel 11, 1-4ff wird berichtet, dass er von seinem Palast aus eine Frau, die Bathseba», baden sah (nackt natürlich…) und sie begehrte. Er liess sie in seinen Palast holen und hatte Sex mit ihr.
- Bathseba wurde schwanger. David verstrickte sich in der Folge dann in weiteren Sünden und als der Mann von Bathseba im Krieg dann starb, gab es eine Hochzeit und dachte David, dass alles im Butter wäre. Fehlanzeige.
- Gott sprach zu dem Propheten Nathan und der konfrontierte David mit seinem Seitensprung.
Wo nun David im Vergleich zu Saul anders reagierte und für uns ein Vorbild sein kann:
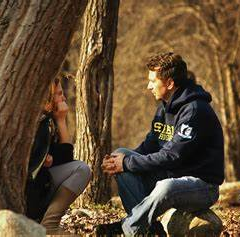
Erstens: David ist bereit seine Schuld einzusehen und als Sünde und Vergehen gegenüber Gott und Mensch zu erkennen (2. Samuel 12,13ff). König Saul hingegen schlug um sich, nicht in sich und deshalb endete sein Mandat.
Zweitens: Bekannt ist das Schuldbekenntnis von David, weil er dies in Psalm 51, einem Busspsalm, den er im Rückblick auf sein Vergehen des Ehebruches mit Bathseba schrieb:
Hier die markantesten Verse aus Psalm 51, 11-14 dazu:
11 Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden, und tilge alle meine Missetat.
12 Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen
neuen, beständigen Geist.
13 Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm
deinen heiligen Geist nicht von mir.
14 Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem
willigen Geist rüste mich aus.
Aquila und Priszilla: Ein Ehepaar, das für andere da war:
Das Ehepaar Aquila und Priscilla steht für so viele in der Bibel, die anderen zur Seite standen, sie in ihrem Dienst unterstützten.

Eine kurze Betrachtung gibt Einblick in das Wirken von Aquila und Priszilla und zeigt auf, dass dieses Ehepaar sich in verschiedene Personen investierten und auch bereit waren, ihren Wirkungsort zu verändern.
49. nach Christus von Rom nach Korinth: Unterstützung von Paulus
- 49. n. Christus (Apg 18,2) wechselt das Ehepaar ihren Standort von Rom nach Korinth. Dies, weil Kaiser Klaudius allen Juden gebot, Rom zu verlassen.
- Paulus befindet sich gerade in einer eher entmutigenden Situation nach seinem Aufenthalt in Athen und findet Unterkunft und Arbeit bei Aquila und Priscilla in Korinth (Apg 18,3).
- Offenbar hat Aquila und Priszilla Paulus in dieser Zeit, indem sie gemeinsam lebten, arbeiteten und Paulus vermutlich auch ermutigt haben, weiterhin als Apostel aktiv zu sein – auch wenn der Erfolg momentan nicht so gegenwärtig war (Apg 18,4).
51. 52 n. Christus von Korinth nach Ephesus: Begleitung von Paulus und Support/Mentoring von Apollos
- 51. /52. n. Christus verliesse Paulus Korinth und machte sich auf den Rückweg nach Antiochien in Syrien (sozusagen seiner Ausgangslage seiner Missionsreisen).
- Nach Apg 18,18-22 begleiteten ihn das Aquila und Priszilla. Diese blieben dann in Ephesus.
- Hier unterstützten sie die Christen und speziell wird in Apg 18,24-28 erwähnt, dass sie den leidenschaftlich aktiven und rhetorisch begabten Apollos genauer in die christliche Lehre einführten und begleiteten. Laut Apg 18,26 nahmen sie Apollos bei sich auf und unterstützten und begleiteten ihn in seinem Dienst.
55. n. Christus in Rom. Offensichtlich ist das Ehepaar Aquila und Priszilla wieder in Rom:
- Paulus schreib während eines dreimonatigen Aufenthalts in Korinth 55. n. Christus den Brief an die Gemeinde in Rom.
- Im Briefschluss, Kp 16,3-5a sendet er Grüsse an das Ehepaar. Es ist so eine richtige «Laqudatio» auf Aquila und Priszilla:
3 Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus.
4 Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten, und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nichtjüdischen Gemeinden.
5 Grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt.
- Auch hier stellen wir wieder fest, dass das Ehepaar ihr Haus für andere öffnete und in Rom stellen sie nun ihre Wohnung für Treffen der Gemeinde zur Verfügung.
62./64 n. Christus – weiterhin in Ephesus; offensichtlich zur Unterstützung von Timotheus und als Mitarbeiter der Gemeinde in Ephesus:
- 62./64. n. Christus schreibt Paulus ebenfalls aus der Gefangenschaft seinen letzten Brief, den 2. Timotheusbrief.
- Timotheus ist zu dieser Zeit in Ephesus. Er dient der Gemeinde dort als Pastor.
- In Kp 4,19 befinden sich Grüsse an Aquila und Priszilla:
19 Grüße Priska und Aquila sowie die Familie des Onesiphorus.
- Das Ehepaar ist also wieder in Ephesus – vermutlich zur Unterstützung von dem jungen Timotheus.
Schlussfolgerung:
- Diese kurze Betrachtung illustriert, wie wichtig der Dienst der Unterstützung anderer in herausragenden Lebenssituationen ist.
- Aquila und Priszilla waren da für andere. Wir lesen von ihnen nicht, dass sie selber predigten oder lehrten – jedenfalls was öffentlichen Dienst betrifft.
- Sie waren in der Begleitung, dem Mentoring, der Unterstützung Anderer aktiv. Sie dienten Paulus, Apollos, Timotheus und sicher vielen anderen Christen.
- Wenn wir nach einer Konkordanz unter dem Stichwort «einander» oder «dienen» nachschlagen, finden wir viele Hinweise, wie wir einander unterstützen und dienen können. Aquila und Priszilla sind zwei Beispiele, die das leidenschaftlich praktizierten.
Hilfreiche Literatur für weitere Vertiefung in das Thema:
- Gordon MacDonald; Getrieben oder Berufen
- H. Wayne House; Chronologische Tabellen und Hintergrundinformationen zum Neuen Testament
- John Bevere; Wartezeiten - Wüstezeiten
- Markus Schmidt; Wachstum ist kein Zufall
- Miroslav Volf; von der Ausgrenzung zur Umarmung
- Roland Hardmeier; Die grosse Story der Bibel von Genesis bis Offenbarung
- Stanley Hauerwas & William H. Willimon; Christen sind Fremdbürger
Der Kirchenvater Augustinus von Hippo (354 n. Chr. – 430 n. Chr.); Ein Repräsentant aus der Epoche Kirchengeschichte des Altertums, 100 n.Chr. – 590 n.Chr.:
Augustinus steht für Menschen, die Gott aus einem turbulenten und gottlosen Leben erreichte und dann eine radikale lebenswende stattfand.
Augustinus ist wohl der grösste Theologe seiner Zeit. Er stand an einem Weltgeschichtlichen Wendepunkt. Die Völkerwanderung brachte das alte Römerreich ins Wanken.
Das Leben von Augustinus:
354 wurde er in Tagaste, Nordafrika geboren. Seine Mutter Monika erzog ihn im christlichen Glauben. Er lernte Latein, hasste aber das Griechisch. In Madura studierte er weiter, und später in Karthago, wo er sich in Rhetorik ausbilden liess.
Dort war er frei von häuslichem Einfluss und lebte wie andere Studenten seinen Leidenschaften und der freien Liebe, der 372 ein Sohn entsprang. Zwei Jahre darauf, au der Suche nach der Wahrheit, nahm er die mänichäische Lehre an, war enttäuscht und wandte sich nach dem Lesen von Ciceros «Hortensius» und neuplatonischen Lehren der Philosophie zu. In seiner Heimat und in Karthago lehrte er Rhetorik, bis er 384 nach Mailand ging.
386 bekehrte er sich dort, nachdem er aus dem Nachbarhaus Kinderstimmen «nimm und lies» (ein christliches Lied) singen hörte. Er griff zur Bibel und las Römer 13,13-14 – und kam zum Glauben. Damit gab er sein bisheriges Leben auf. Seine Mutter starb kurz nach seiner Taufe 387. 391 wird er in Karthago zum Priester geweiht. 396 wurde er Bischof von Hippo und blieb bis zu seinem Tode 430 ein bischöflicher Verwalter der Kirche.
Die Werke von Augustinus:
Bekenntnisse:
- Sie sind die Biographie seines seelischen Werdeganges. Buch 1-7 beschreiben sein Leben vor seiner Bekehrung, Buch 9-10 Geschehnisse nach seiner Bekehrung einschliesslich Tod der Mutter und Rückkehr nach Nordafrika.
- Viele Aussprüche aus diesen Bekenntnissen sind sehr bekannt geworden, z. B.: «Denn zu dir hin sind wir geschaffen, und ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in Dir.»
Über den Gottesstaat (de civitate dei):
- Dieses Werk entstand ursprünglich als ein Apologie. Aber es hat Bedeutung weit darüber hinaus.
- Augustin stellt darin seine Geschichtsphilosophie dar und zeigt, dass die Geschichte der stetige Kampf von Gottesstaat und Menschenstaat ist. Das grösste Unterscheidungsmerkmal ist die Liebe.
- Der geistliche Staat hat Erhabenheit über dem irdischen. Alles zielt hin auf das göttliche Ziel.

Seine Gnadenlehre:
- Die Gnadenlehre Augustins ist deshalb bedeutend, weil die Reformation auf sie zurückgriff und sie von daher uns heute wesentlich geprägt hat.
- Für Augustin ist Gott das höchste Sein und höchste Gut.
- Ursprünglich war der Mensch in Freiheit des Willens geschaffen. Aber Adam und Eva missbrauchten diese Freiheit und wandten sich dem Geschaffenen zu. Durch diese Sünde fielen sie in ein ungeordnetes und massloses Begehren, das sie als Menschen stets umtreibt. Der Mensch ist aber aus sich unfähig zum rechten Erkennen und Handeln.ER steht unter dem Zwang zum Sündigen. Er kann nicht nicht sündigen.
- Christus befreit von diesem Zwang. Er trug unsere Strafe und hat uns aus der Gewalt des Bösen herausgerissen. Gott ist genüge getan (vgl. dazu 2. Kor 5,11-21). Deshalb erhalten wir Sündenvergebung und sind auf dem Weg zur progressiven Heiligung. Wir können jetzt zwar immer noch sündigen, aber wir müssen es nicht mehr.
Schlussgedanken:
Für seine Zeit hat Augustin enorm viel verstanden und bewegt. Klar, er blieb ein Kind seiner Zeit und der Bruch zu Dogmen, die in der Reformation dann im Zentrum bekämpft wurden, Anlass der Reformation waren, lehrte Augustin noch (Sakramente und auch die Lehre von dem Fegefeuer). Die Protestanten sehen in ihm aber ein Vorläufer der Reformation.
Der Reformator Martin Luther (1483 n. Chr. – 1546 n. Chr.); Ein Repräsentant für schenkende Gnade und Gerechtigkeit:
Es ist sicher verständlich, dass ich auch bei Martin Luther nur einzelne Aspekte erwähnen kann. Eben Aspekte, die ich als «vorbildlich» und deshalb zur Nachahmung empfehle. Seine Standpunkte und Kampf gegen die Missstände in der Kirche haben neben ihm (sogenannte Vorreformatoren) bereits vor Luther angeprangert. Zum grossen Durchbruch kam es aber durch Luther und die deutsche Reformation.
Ursachen, die zur Reformation führten: (Auszug aus Kirchengeschichtsnotizen von Dozent Wolfgang Klippert, S. 79):
«Die Reformation wird je nach eigenen Standpunkten verschieden gedeutet:
- Der protestantische Historiker sieht in ihr eine religiöse Bewegung, die eine Rückkehr zum reinen Evangelium vollzog. Hier werden allerdings oft politische, kulturelle und andere Faktoren übersehen.
- Römisch-katholische Historiker sehen in der Reformation das Auseinanderbrechen der mittelalterlichen Einheit der Kirche. Dabei wird aber oft übersehen, dass die Kirche ein einem wirklich reformbedürftigen Zustand war und auf die lutherischen Reformen nicht einging.
- Weltliche Historiker legen mehr die Betonung auf zweitrangige Folgeerscheinungen wie die Gewissensfreiheit oder die Freiheit Deutschlands von italienischer Bevormundung usw.»
Klar, jeder dieser Standpunkte hat irgendwelche richtigen Gesichtspunkte. Fakt ist, dass sich die Reformation nicht mit einem Satz erklären lässt. Sie ist das Ergebnis einer Menge von Ursachen. Einige will ich hier anführen:
Politische Faktoren, die zur Reformation führte:
Die nordeuropäischen Staaten entwickelten sich immer mehr zu Nationalstaaten. Diese wehrten sich gegen den Gedanken, von irgendeiner zentralen Macht ausserhalb ihres Staates gelenkt oder bevormundet zu werden. Das galt auch für die Kirche. Besonders der Mittelstand sah nicht ein, warum ein Ausländer wie der Papst das Sagen haben sollte.
In Deutschland selber herrschte zwar immer noch das Kleinstaatentum. Aber auch diese wollten keine andere Autorität als die ihre in ihrem Land dulden. Die Reformation gab die Gelegenheit, diese Bevormundung abzuschütteln.
Ökonomische Faktoren, welche die Reformation unterstützte:
Die römisch-katholische Kirche besass viele Ländereien, nach denen die nationalen Herrscher, Adelige und Mittelständische gierten. Zuviel Geld ging an die päpstlichen Schatzkammern in Rom verloren, ausserdem war der Klerus von Steuern befreit. Hinzu kamen Inflation und steigende Lebenshaltungskosten.
Intellektueller Faktor:
Der Mittelstand hatte eine individualistische Einstellung und lehnte sich gegen die mittelalterliche Vorstellung von der Gesellschaft auf. Das neue freiheitliche Prinzip, das vom Humanismus mitgeprägt wurde, fiel für Rom ungünstig aus. Man hatte keine Religionsanschauung mehr, sondern eine Weltanschauung.
Moralische Faktoren (Zustände in der Kirche), die nicht mehr tragbar waren:
Dieser moralische Faktor war eng mit dem intellektuellen Faktor verbunden. Man sah nämlich den krassen Gegensatz zwischen der neutestamentlichen Gemeinde und den Zuständen in der römisch—katholischen Kirche. In ihr fand man Korruption, Handel mit geistlichen Ämtern, Ämterhäufung, käufliche Rechtssprechung und ein oft unmoralisches Leben bei den Geistlichen.
Einzelne «Vorreformatoren»:
Hier wäre John Wiclif (1321 n. Chr. – 1384 n. Chr.) zu erwähnen:
Er kämpfte zusammen mit dem mächtigen Herzog von Gent dafür, dass der Papst Ämter in der römischen Kirche nicht mehr selber einsetzen konnte.
Wiclif war den grössten Teil seines Lebens Schüler und später Professor an der Universität von Oxford.
Nach 1378 n. Chr. kam Wiclif zu weitreichenden ekklesiologischen Schlussfolgerungen. Christus und nicht der Papst sei Oberhaupt der Kirche. Wenn der Papst ein apostolisches Leben führe, könne man ihn beibehalten. Die Bibel und nicht die Autorität des Papstes sei alleinige Grundlage der Kirche und Massstab aller Gläubigen.
Von daher übersetzte er auch die Biel ins Englische. 1382 n. Chr. widersprach er dem Dogma der Transsubstantion. Damit griff er die zentrale geistliche Macht der Kirche an.
Johannes Huss (1369 n. Chr.- 1415 n. Chr.).
Aufgrund der regen Beziehungen zwischen England und Böhmen (der englische König hatte eine böhmische Prinzessin geheiratet) waren über Studenten zahlreiche Schriften Wiclifs an die Prager Universität gelangt und auf fruchtbaren Boden gefallen. Besonders der Dekan uns spätere Rektor der Universität Jan Huss bezog sich in seinen Predigten auf Wiclifs redikale Kirchen- & Sozialkritik.
Die Antwort des Erzbischofs und des Papstes waren Predigtverbot (1410 n. Chr.), Bann (1411 n. Chr.) und 1411 n. Chr. Exkommunikation (Ausschluss) aus der Kirche. 1414 n. Chr. sagte ihm König Sigismund freies Geleit zum Konstanzer Konzil zu. Angekommen wurde er aber eingekerkert und gefoltert. Nach grausamen Verhören wurde er am 6. Juli 1415 n. Chr. verbrannt. Huss soll gesagt haben: «Heute bratet ihr eine Gans, aber aus ihrer Asche wird ein Schwan auferstehen.» Offensichtlich war Luther dann dieser Schwan.
Nun aber zu Martin Luther
Der Vater wollte, dass er Jura studiert – aber er wurde Priester:
Zuerst begann Luther 1501 n.-Chr. an der Universität Erfurt mit dem Studium der aristotelischen Philosophie an. Luther erkannte hier schon, dass göttliches Eingreifen nötig war, wenn de Mensch Wahrheit oder Rettung suchte. 1502 n. Chr. erhielt er sein Bakkalaureat, 1505 n. Chr. seinen Magister der Künste.
Der Vater wollt ihn Jura studieren lassen. Aber 1505 n. Chr., als Luther gerade unterwegs war, kam er in der Nähe von Erfurt in ein starkes Gewitter. In seiner Todesangst gelobte er den Eintritt in ein Kloster.
Zirka drei Wochen später trat er gegen den Willen des Vaters in das Augustinerkloster in Erfurt ein. 1507 n. Chr. wurde er ordiniert. Im Winter 1508 n. Chr. lehrte er ein Semester Theologie an de neuen, vom Kurfürsten Friedlich von Sachsen gegründeten Universität in Wittenberg.
Sein Entsetzen über den Zustand der Kirche:
1510 n. Chr. – 1511 n. Chr. reiste Luther für seinen Orden nach Rom. Anstatt aber eine innerliche Hilfe durch diese Reise zu erlangen, wurde er in eine noch grössere Not gestürzt. Die Verderbtheit und der Luxus innerhalb der Kirche entsetzte ihn.
Die drei Grundsätze (Leitsätze) der lutherischen Reformation:
1511 n. Chr. wurde Luther nach Wittenberg versetzt. Im nächsten Jahr wurde er Professor für Bibelkunde und erhielt den theologischen Doktorgrad. Bis zu seinem Tode blieb er Professor für Theologie.
Bei den Vorbereitungen der ersten Psalmvorlesung 1513 n. Chr. in der Turmstube (noch treffender im Scheisshaus 😊), des Klosters zu Wittenberg kam Luther die Erleuchtung, dass Römer 1, 17 nicht die fordernde Gnade, sondern die schenkende Gnade und Gerechtigkeit Gottes ist.
Wie er, nahmen auch andere Professoren und Studenten den Glauben an, der sich schliesslich mit der Reformation ausbreitete.
Der Buss- & Ablasshandel, der das Boot zum überlaufen brachte:
Luther wollte sein Lehramt auf der Basis der Heiligen Schrift ausüben. Dazu studierte er die Ursprachen der Bibel. Er stellte fest, dass er auch den Schriften von Augustin nicht völlig vertrauen konnte, sondern dass letztlich die Bibel allein die wahre Autorität war.
1513 n. Chr. bis 1515 n. Chr. lehrte er die Psalmen, 515 n. Chr. bis 1517 n. Chr. den Römerbrief, später Galater und Hebräer. In dieser Zeit formulierte er die drei Grundsätze (Leitsätze) der Reformation:
- Allein durch Gnade (sola gratia)
- Allein durch den Glauben (sola fide)
- Allein durch die Heilige Schrift (sola scriptura).
Das Herausfordende daran ist das «Allein», denn selbstverständlich wusste auch die katholische Kirche um Gnade, Glauben und die Schrift.
Im Laufe der Zeit hatte sich das Sakrament der Busse entwickelt. Durch Busse wurden die ewigen Sündenstrafen, falls wirkliche Reue vorhanden war, vergeben. Aber auch die Kirche erlegte Sündenstraffen auf. Sie sind zeitlich und ursprünglich aus seelsorgerlichen Gründen auferlegt worden. Die zeitlichen Sündenstraffen konnten nun aber durch Ablässe erlassen werden.
Durch Zahlung von Geld, durch Wallfahrten usw. konnten sie abgeleistet werden. Im Bewusstsein des Volkes aber wurde die ewige, göttliche Sündenstrafe von der zeitlichen, kirchlichen nicht unterschieden.
So entstand der Glaube, dass man sich mit Geld von den Folgen der Sünde loskaufen könne. Moralisch gesehen führte das zu entsetzlichen Auswüchsen. Kirchlicherseits spielte man mit dieser Verwechslung und nutzte sie für andere Zwecke wie z. B. das Eintreiben von Geldern.
Um diesem Treiben ein Ende zu setzen, schlug Luther am 31. 10. 1517 n. Chr. seine 95 Thesen in lateinischer Sprache an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Damit wollte er eine wissenschaftliche Diskussion über den Ablass herausfordern.
Es ging Luther zuerst um eine Reform innerhalb der Kirche. Allerdings waren die Thesen derart offen und schonungslos und vielen Menschen aus der Seele gesprochen, dass sie bald in die deutsche Sprache übersetzt wurden und überall begierig gelesen wurden. Ein Stein war ins Rollen gekommen.
Der Bruch mit Rom:
- Luthers Vorbild, sich so radikal gegen die gängige Lehre und Praxis der Kirche zu stellen und den wirklichen Sachverhalt der biblischen Aussagen zu entsprechen und zu lehren, ist schon gewaltig.
- Auch wenn die Reformation von Luther nun rückwirkend betrachtet in den Aspekten Abendmahl und Taufe nicht den Überzeugungen vieler freikirchlichen Theologen entsprach, sollten wir uns hüten zu richten. Denn wenn einer alleine gegen die gewaltige Macht der Kirche kämpft, sollten wir das zentrale, das Luther mit der Rechtfertigung durch den Glauben festhalten und nicht urteilen.
- Es ist klar, dass für Luther nun eine schwierige Zeit begann. Er sollte seine Thesen und Standpunkte widerrufen, was er nicht tat.
- Eric Metaxas schildert in seiner Biographie, Luther – Der Mann, der Gott neu entdeckte, S. 303ff eindrücklich, wie Luther flüchten musste, und wie er dann in der Wartburg untertauchte. Dort war er inkognito als Junker Jörg für zehn Monaten und übersetzte das Neue Testament in die Deutsche Sprache. Ein wichtiger Schritt, damit das Volk das Wort Gottes in ihrer Sprach hatten und motiviert waren, Lesen zu lernen.
Bild von der Wartburg
Natürlich, wie das zum Leben eines Reformators gehört, hatte Luther auch Feinde und es gab auch Auswüchse, die Luther wieder korrigieren musste. Es gab Streit um die richtige Praxis und Verständnis von Abendmahl und Taufe. Luthers Heirat (1525 n. Chr.) mit Katharina von Bora, einer sächsischer Adeligen und Zistenzienserin (Nonne), provozierte die damaligen Kirchenführer. Aber die Reformation ging weiter, breitete sich aus und ein grosser Segen entstand durch den Willen, das Wort Gottes so zu lesen und kirchliches Leben so zu praktizieren, wie die ersten Christen es taten.
Erweckungen – wer seht sich nicht danach!? Kurzer Einblick in den deutschen/lutherischen Pietismus:
Hier findest du keine ausführliche Abhandlung über Erweckungsbewegungen, sondern lediglich einzelne Aspekte, sie Menschen der Neuzeit – speziell im Pietismus - begannen, gesellschaftliches Leben zu verändern.
Ursachen für die Entstehung des Pietismus:
- Die erstarrte Orthodoxie
- Die stärkere Wertschätzung des Einzelnen
- Betonung des Gefühls
- Konkrete Erneuerung des praktischen Lebens
- Weiterführung der Reformation
Wenn wir die verschiedenen Vorbilde und Richtungen im Pietismus (Frömmigkeit) studieren stellen wir auch fest, dass dies enorm positive Auswirkungen in der Gesellschaft hatte. Es entstanden Schulen, Spitäler, Armenhäuser, Internate, Bibelgesellschaften usw.
Aber weil die Heiligung oft stärker betont wurde als die Rechtfertigung durch den Glauben durch die Gnade Gottes, konnte dies bei Einzelnen zu einer permanenten Sündenangst führen.
- Ich persönlich bin im Umfeld einer Kirche aufgewachsen, die diese Betonung legte;
- Dies führte, aus meiner Sicht beurteilt, zu einem Glaubensumfeld, welches eher Verbote, statt die Freiheit in Jesus Christus lehrte und lebte;
- Oft hatte ich den Eindruck, dass dies zu meinem Umfeld von einer frommen Selbstspiegelung führte;
- Später musste ich mich davon lösen – nicht von den guten Prägungen wie die Bibel lesen, Gottesdienste besuchen usw., sondern von den verkappten Traditionen und Meinungen wie Bier trinken ist nicht gut, Tanzen ist schlecht, Kartenspiel ist keine gute Sache und ein Christ geht an kein Dorf-Fest und so Zeug.
Abschliessend nun den Hinweis auf das Vorbild von Philipp Jakob Spener (1635 n. Chr. – 1705 n. Chr.):
Er war der eigentliche Begründer des deutschen und lutherischen Pietismus. Aufgewachsen ist er in einem tiefgläubigen Elternhaus. In Strassburg studierte er Theologie und erhielt seinen Doktortitel.
Nach dem Studium wurde er Pfarrer in Frankfurt, wo er ganze biblische Bücher «durchpredigte», die Konfirmation ganz neu einsetzte und Gebets- & Fastentage einrichtete. 1691 n. Chr. wurde er Probst in Berlin, wo er auch gestorben ist.
Das Hauptwerk Speners ist/sind seine «pia desideria» (Fromme Wünsche) aus dem Jahre 1675 n. Chr. Darin legt er ein ganzes Programm vor, das grundlegend für den lutherischen Pietismus wurde:
- Lesen der ganzen Schrift als einziger Quelle der Offenbarung und des Glaubens;
- Allgemeines Priestertum und die praktische Verwirklichung;
- Ernstes Glaubensleben, das aus der Kraft der Rechtfertigung in eine aktive Veränderung des Lebens drängt;
- Praktisches Tun der Nächsten-& Feindesliebe;
- Reform der Theologenausbildung hin zu Pfarrern mit geistlichen Qualitäten vor blankem Wissen;
- Collegia pietatis, d. h. Hauskreise zur frommen Auferbauung der Glaubenden und somit der Gemeinde.
Es lohnt sich, z. B. im Internet nach weiteren Vorbildern jener Zeit nachzuforschen. Vorbilder wie
- August Hermann Franke
- Johan Albert Bengel
- Ludwig Graf von Zinzendorf
Im Anhang findest du auch Literatur, welche dir viele tolle Vorbilder der Kirchengeschichte näherbringen kann.
Hilfreiche Literatur für weitere Vertiefung in das Thema:
- Adolf Harnack; Chronologie der Literatur von Irenäus bis Eusebius
- Benedikt Peters; George Whitefield – Der Erwecker Englands und Amerikas
- Eric Metaxas; Luther – Der Mann, der Gott neu entdeckte
- Eric Metaxas; Sieben Frauen, die Geschichte schrieben
- Eric Metaxas; Sieben Männer, die Geschichte schrieben
- Eric Metaxas; Bonhoeffer – Pastor, Agent, Märtyrer und Prophet
- Eric Metaxas; Wilbeforce - Der Mann, der die Sklaverei abschaffte
- E. H. Broadbent; Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt. Ein Gang durch ihre zweitausendjährige Geschichte
- Iain H. Murray; Jonathan Edwards – ein Lehrer der Gnade und die Grosse Erweckung
- Michael Kotsch; Helden des Glaubens, Band I: 33 Kurzbiografien aus der Kirchengeschichte
- Michael Kotsch; Helden des Glaubens, Band II: 22 Kurzbiografien aus der Kirchengeschichte
- TH. Brandt; Kirche im Wandel der Zeit, Teil II: Reformation bis Gegenwart
- Peter Zimmerli; Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und die Herrnhuter Brüdergemeine
- Wolfgang Klippert; Kirchengeschichtsnotizen zu seinen Vorlesungen, 1984-1987
Hier geht es nun um Personen der Gegenwart. Personen, die noch leben oder die du während deinem Leben kennengelernt hast oder Berichte über die gelesen oder gehört hast und dies dich inspiriert hat:
Bemerkung zur Zeitspanne «Gegenwart/Zeitgenössisch oder Neuzeit»:
- Es ist nicht ganz einfach, diese Zeitspanne zu definieren;
- Ein Datum, das für den Anfang der Neuzeit angegeben wird, ist 1648 n. Chr., das Ende des Dreissigjährigen Krieges.
Einladen, selber zu reflektieren, welche Personen der Gegenwart für dich Vorbilder sind:
- Evtl. Vorbilder in deiner Kirche
- Vorbilder auf deinem Lebensweg (Wenn diese noch leben, kontaktiere sie und danke ihnen für den Einsatz und der Investition in dein Leben).
Kriterien, was Vorbilder ausmachen, welche Werte sie vertreten:
- Evtl. Verhaltensweisen, Eigenschaften, welche du bei den Personen weiter oben nun vorgestellt bekommen hast
- Personen, welche die Werte der Bibel, Ethische und Moralische Standpunkte nach der Bibel vorbildlich gelebt haben.
Unten gebe ich dir Hinweise auf Literatur, auf Quellen, welche dir Einblick zu Charakter oder Verhaltensweisen geben können und du so reflektieren kannst, wer in deinem Umfeld so ist und somit ein Vorbild sein kann für dich:
Hilfreiche Literatur für weitere Vertiefung in das Thema:
- Dietrich Bonhoeffer; Ethik
- Georg Huntemann; Die Zerstörung der Person – Umsturz der Werte
- Karl Barth; Das christlich Leben
- Karl Barth; Ethik Teil I & Teil II
- Klaus Bockmühl; Gott im Exil – Zur Ethik der Neuen Moral
- Klaus Bockmühl; Leben mit dem Gott, der redet. Leben aus dem Evangelium; Hören auf den Gott, der redet
- Wolfgang Trillhaas; Ethik
Bemerkung zu einer Auswahl von persönlichen Vorbildern aus der Bibel:
Rückblickend auf mein Leben und meinen christlichen Dienst möchte ich hier vier Vorbilder erwähnen, die mir durch ihr Verhalten stets ein Vorbild waren. Es geht um Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften dieser Personen. Die hat mich immer wieder motiviert, dran zu bleiben. Hier die vier Vorbilder (Klar, das ist nur eine Auswahl):
Josua: Heerführer, Diener von Mose; Landeinnehmer:

Einzelne Charakterzüge, die mich bei der Josua begeistern, die mich immer wieder motiviert haben, dran zu bleiben, um selber motiviert zu sein und andere motivieren zu können:
- Er diente Mose…
- Er war ja eigentlich ein Heerführer, ein Kämpfer
- Er führte das Volk über den Jordan in das verheissene Land
- Er wollte im neuen Land, als sie das Land einnehmen wollten und Kriege verloren, wissen, wo das Problem war, wo Sünde war (Kp 7,7)
- Er Blieb Gott treu, auch wenn es andere nicht waren; Text: Jos 24,15
Jesus Christus: Sohn Gottes/Gott; Vollkommen, Wegbereiter, Schöpfer, Erlöser, Mittler, Hohepriester, König aller Könige:

Jesus war und ist für mich das grösste Vorbild. Immer und immer wieder war und ist Jesus für mich das zentrale Vorbild, um das wichtigste im Blick zu haben, den Vater zu sehen;
Einzelne Charakterzüge von Jesus, die ich besonders bemerkenswert finde:
- Wissen, wo es sich nicht lohnt zu antworten und zu schweigen (BS, Jesus aber schwieg stille z. B. Mk 14,61:
- Wissen, wo es richtig ist zu reden, wenn es ums Zentrum ging (Text, Sturm des Tempelvorhofes, Gebetshaus: Mk 11,15:
- Dranbleiben, auch wenn andere weggehen (Weiter zu gehen, auch alleine; z. B. Joh 6, 67
- Den Weg bis zum Schluss gehen, bis ans Kreuz (Bereit sein, Ablehnung anzunehmen ohne sich ständig zu rechtfertigen:
Barnabas (Joseph – Levit, aus Cypern: Apostel, Mentor von Paulus, Johannes-Markus: Bewährter Mann; Voll Heiligen Geistes und Glaubens; Sohn des Trostes:
Einzelne Charakterzüge von Barnabas, die ich besonders bemerkenswert finde:
- Bereit sein, sein Geld und Gut für die Kirche zu spenden (Apg 4,36-37)
- Voll Heiligen Geistes (Apg 11,24)
- Verbindungsglied für Paulus zu den Aposteln (Apg 9,27)
- Sah das Potential von Paulus und von Johannes Markus (Apg 11,25, 15,36ff)
- Hatte die Grösse ins zweite Glied zurück zu gehen zum Nutzen von dem Reich Gottes (Apg 14,12-15,2 – da war der Wechsel).
Was ich von Barnabas lernte und auch weiterempfehlen möchte:
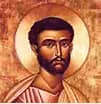
Er investierte sich in einzelne Personen:
In Paulus – ohne Barnabas kein Paulus und damit hätten wir einen grossen Teil
von dem NT nicht;
In Johannes-Markus: Johannes-Markus schreib später das Markusevangelium –
Ausgangspunkt für die synoptischen Evangelien.
Barnabas musste nicht recht haben:
- Er konnte zurückstehen; Es musst nicht unbedingt so gehen, wie er wollte;
- Er war ein Mensch voll Heiligen Geistes;
Er erkannte, wann es Zeit ist ins zweite Glied zu treten:
- Während der ersten Missionsreise kam plötzlich der Wechsel.
- Zuerst heisst es: Barnabas aber und Paulus; dann Paulus und Barnabas
William Carey: Schuhmacher, Missionar in Ostindien, Professor, Sprachforscher, Bibelübersetzer 17. August 1761 n. Chr. – 9. Juni 1834 n. Chr.:

Was mich an diesem Mann so begeistert und er mir ein Vorbild ist als Kämpfer:
- Er war ein einfacher Mann, Schuhmacher.
- Was er lernte, erlernte er als Autodidakt. Was er wusste, hat er sich selber beigebracht.
- Er war Schumacher und wurde Professor (er war nie an einer Uni…), und doch wurde dennoch Professor an der Universität J
- Weil keine Missionsgesellschaft ihn nach Indien senden wollte, gründete er eine eigene Missionsgesellschaft.
- Er wurde von Personen aus dem Heimatbüro betrogen. Er machte weiter.
- Er machte weiter, auch als, seine Frau starb; die Entwürfe für Bibelübersetzungen verbrannten; das Augenlicht wegging
Hilfreiche Literatur für weitere Vertiefung in das Thema:
- Markus Spieker; Jesus – Eine Weltgeschichte
- S. Pearce Carey; William Carey – Der Vater der modernen Mission
